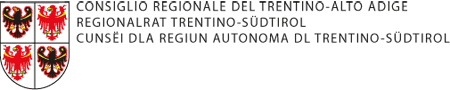Pressemitteilungen
Debatte zur Autonomiereform
Beschlussfassungsvorschlag Nr. 12: Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates für das Finanzjahr 2024 (eingebracht vom Präsidium auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates). Das Finanzjahr 2024 ist mit festgestellten Gesamteinnahmen auf Kompetenzrechnung in Höhe von 52.276.898,07 Euro (inklusive der Verwendung des Verwaltungsüberschusses des vorhergehenden Finanzjahres im Ausmaß von 9.132.060,98 Euro und des zweckgebundenen Mehrjahresfonds im Ausmaß von 220.217,29 Euro) und zweckgebundenen Gesamtausgaben in Höhe von 43.664.021,22 Euro (der zweckgebundene Mehrjahresfonds im Ausmaß von 246.077,59 Euro miteingeschlossen) abgeschlossen worden, so dass sich ein Kompetenzüberschuss in Höhe von 8.612.876,85 Euro ergibt.
Die Rechnungslegung wurde ohne Debatte mit 31 Ja, 4 Nein und 21 Enthaltungen genehmigt.
Beschlussfassungsvorschlag Nr. 13: Stellungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol/Alto Adige“ (auf Initiative der Regierung), nach vorheriger Prüfung vonseiten der 3. Gesetzgebungskommission.
Arno Kompatscher, Präsident der Region, verwies auf die Debatte in den beiden Landtagen und auch in der Öffentlichkeit zur Reform. Er wollte festhalten, dass es bei dieser Reform um einen spezifischen Bereich und einen spezifischen Auftrag gegangen sei. Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts habe trotz Besserstellungsklausel zu einer Verschlechterung der Autonomie geführt. Dieser stetigen Aushöhlung wollte man Einhalt gebieten und das Verlorene wiederherstellen. Als sich Ministerpräsidentin Meloni zur Wiederherstellung bereit erklärt habe, habe man die Gelegenheit genutzt. Vor diesem Hintergrund sei darüber hinaus nicht vieles möglich gewesen, und doch habe man einige Zusatzbestimmungen einfügen können, etwa zur Rolle der Sechserkommission. Am wichtigsten sei der Wegfall der staatlichen Wirtschafts- und Sozialreformen als Einschränkung der Autonomie. Die Durchführungsbestimmungen könnten nun auch Zuständigkeitsfragen klären. Die Einvernehmensklausel sei nicht in jener harten Form erreicht worden, die vorgeschlagen wurde, aber ohne Einvernehmen könne das Parlament keine Abstriche an der Autonomie mehr vornehmen. Bemerkenswert sei auch, dass der Staat nun auch die Verankerung im Völkerrecht explizit einräume und dass der Minderheitenschutz als Grundlage anerkannt werde.
Präsidentin Eleonora Angeli berichtete von den Arbeiten in der 3. Gesetzgebungskommission und den Anhörungen von Verfassungsexperten und den beiden Landeshauptleuten Fugatti und Kompatscher. Die Kommission hat dabei auch die von den beiden Landtagen vorgenommenen Anmerkungen zum Verfassungsgesetzentwurf übernommen (siehe Anhang zum Beschlussfassungsvorschlag).
Andrea de Bertolini (PD) betonte, dass es sich um eine Änderung des Statuts handle, nicht um eine große Reform. Es sei nachvollziehbar, dass man die Serie der einschränkenden Urteile des Verfassungsgerichts stoppen wollte. Er kritisierte, dass diese Privatverhandlungen zwischen den Landeshauptleuten und der Regierung keine Beteiligung der anderen politischen Kräfte ermöglicht habe. Viele wichtige Bereiche seien bei dieser Reform ausgespart worden. Auch die neue Funktion der Durchführungsbestimmungen gebe Anlass zur Sorge.
Bernhard Zimmerhofer (Süd-Tiroler Freiheit) ging auf die Geschichte der EU ein mit ihren vielen Erwartungen, die vielfach enttäuscht wurden. Es brauche ein föderalistisches Europa, um den neuen Herausforderungen begegnen zu können. Die Autonomie sei im Laufe der Jahre ausgehöhlt worden. Mit dieser Reform blieben wichtige Anliegen unberücksichtigt, die Senkung der Ansässigkeitsklausel sei angesichts des Zuzugs in den letzten Jahren nicht nachvollziehbar. Auch die Finanzautonomie sei ausgehöhlt worden, die Zweisprachigkeitspflicht werde nicht eingehalten. Insgesamt eine katastrophale Bilanz für die Regierung der Kompatscher. Migration und Wohnungsnot hätten sich dramatisch verschärft. Einige Lichtblicke gebe es bei dieser Reform, aber die negativen Aspekte würden überwiegen. Eine gesicherte Zukunft für Südtirol gebe es nur in einem föderalistischen Europa der Regionen.
Lucia Coppola (Grüne) kritisierte die Geheimverhandlungen zu dieser Reform, während das Statut den Landtagen und dem Regionalrat das Initiativrecht für Änderungen an der Autonomie zuweise. Sie verwies auf die Besserstellungsklausel, die nichts gebracht habe, sowie auf die Konvente zur Autonomie, deren Ergebnisse unberücksichtigt geblieben seien. Die vorgeschlagene Reform stelle einige verlorene Kompetenzen wieder her, bringe aber auch einige zusätzliche Kompetenzen. Einige dieser Neuerungen seien kritisch zu sehen, etwa zur Energie, wo das Land Teilnehmer und Schiedsrichter zugleich sei, oder zur Umwelt. Eine Modernisierung des Statuts, die auf die Veränderungen in der Gesellschaft eingeht, sei nicht in Sicht. Sie werde sich der Stimme enthalten.
Brigitte Foppa (Grüne) bemerkte ein Desinteresse der Exekutive an dieser Debatte. Diese Reform werde von den einen als großer Fortschritt, von den anderen als Landesverrat gesehen. Die Grünen würden dem Gesamtpaket zustimmen. Es enthalte neben der Wiederherstellung verlorener Zuständigkeiten auch Verbesserungen im Sinne des Zusammenlebens, etwa die Reduzierung der Ansässigkeitsklausel oder die Vertretung der Italiener in den Gemeindeausschüssen. Kritisch sehe man die mögliche Zusammensetzung der Landesregierung nach Volksproporz - dafür sollte es eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Kritisch zu sehen sei auch die neue Zuständigkeit für die Umwelt. Hier bestehe die Gefahr von Interessenkonflikten, vor denen bereits Benedikter gewarnt habe. Art. 98 des Gesetzentwurfs gehe hingegen eindeutig nicht in die richtige Richtung, dort gehe es um die Zuständigkeit für die Anfechtung von Staatsgesetzen.
Chiara Maule (Campobase) betonte, dass es einen dynamischen Ansatz brauche, um die Autonomie am Leben zu halten. Sie kritisierte die mangelnde Einbindung des Regionalrats. Das Resultat sei insgesamt gut, aber es blieben einige Probleme, die noch der Klärung bedürften. Es seien auch einige wichtige und erhoffte Themen ausgespart worden. Gleichwohl werde man dem Entwurf zustimmen.
Hannes Rabensteiner (Süd-Tiroler Freiheit) bezeichnete die Reform als trojanisches Pferd und als Schwächung der Minderheitenrechte. Es sei gesagt worden, dass es sich um einen Kompromiss handle, für den man auch etwas geben musste. Südtirol habe etwas geben müssen, das Trentino nicht. Es gehe hier um ein verbrieftes Recht der Minderheit, aber von den Neuerungen profitiere nur die italienische Volksgruppe in Südtirol. Auch Experten hätten vor dieser Schwächung der Minderheitenrechte gewarnt.
Francesco Valduga (Campobase) hätte sich mehr Einbindung des Regionalrats und der Landtage erwartet. Diese Reform trage vor allem Südtiroler Handschrift, aber auch das Trentino profitiere davon - es hätte sich aber mehr einbringen können. Die Reform bringe die Wiederherstellung von Kompetenzen, aber auch neue Zuständigkeiten, etwa zum Wildtiermanagement oder zum Handel. Die eigentliche Neuerung komme für die italienische Sprachgruppe in Südtirol, das sei etwas, was auch die römische Regierung wollte, ein Zeichen, dass die italienische Rechte nicht so autonomiefreundlich sei, wie sie tue. Man werde sehen, wie sie sich beim Einvernehmen verhalten. Diese Reform bringe Fortschritte, sei aber noch kein 3. Statut.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) gab Valduga recht: Es sei ein Trugschluss, wenn man annehme, dass diese Regierung plötzlich autonomiefreundlich geworden sei. Es sei auch bezeichnend, wenn sich ein Urzì, der immer gegen die Autonomie geredet habe, sich nun als Autonomiefreund ausgebe. Umso kritischer sollte man seine Punkte in dieser Reform sehen. Mit dieser Reform werde auch der faschistische Namen “Alto Adige” festgeschrieben, auch in der deutschen Fassung des Statuts. Das Argument, dass man bei Verhandlungen auch etwas geben müsse, sei nicht berechtigt, wenn es um Minderheitenrechte gehe. Es hätte keine Notwendigkeit gegeben, die Ansässigkeitsklausel zu schwächen, auch angesichts der Zuwanderung. Knoll verwies auf die angekündigte Durchführungsbestimmung, mit der der Proporz bei Staatsstellen ausgehebelt werde. Es bestehe die Gefahr, dass die Autonomie zur Folklore-Autonomie werde wie in Aosta. Das Recht auf Muttersprache in Ämtern und Sanität sei nicht mehr garantiert. Die Kernfrage zu dieser Reform sei, ob sie der Minderheit mehr bringe. Sie bringe Deutschen und Ladinern nichts, und daher werde seine Fraktion dagegen stimmen.
Die Autonomie müsse ein dynamischer Prozess sein, um auf die geänderten Umstände eingehen zu können, betonte Michele Malfer (Campobase). Umso mehr sei die Methode der Geheimverhandlungen zu kritisieren. Davon abgesehen sei der Inhalt zu würdigen. Es würden Fortschritte gemacht, aber es fehle die große Vision, die Einbindung in den europäischen Kontext. Man werde für den Entwurf stimmen, aber ohne Jubelgeschrei und mit dem Aufruf, mehr zu erreichen.
Renate Holzeisen (Vita - Wir Bürger) erinnerte daran, dass viele Zuständigkeiten an die EU übertragen wurden, eine EU, die nicht mehr Ausdruck von Demokratie sei, sondern eine autoritäre Einrichtung, die von globalen Wirtschaftslobbys gelenkt werde. Bezeichnend seien die SMS von der Leyens an den Pfizer-Chef. Sie werde gegen diese Reform stimmen, denn darin sei auch verankert, dass die Region und die beiden Provinzen sich an den europäischen Rechtsrahmen halten müssten. Damit werde die Autonomie mit der Zeit ausgehöhlt und ausgelöscht.
Luis Walcher (SVP) unterstrich die Bedeutung der Autonomie für Südtirol und das Trentino, besonders für die Minderheiten. Er erinnerte an den langen Weg bis zum 2. Autonomiestatut, das erst den Minderheitenschutz und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Provinzen garantiere. Die Autonomie müsse ständig weiterentwickelt werden, und die heutige Reform sei ein Schritt auf diesem Weg. Die Schranke der wirtschaftlich-sozialen Reformen falle, und es werde nur mehr auf die allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung verwiesen. Walcher nannte eine Reihe von Bereichen in seinem Ressort, die davon betroffen seien. Bei Wolf und Bär etwa seien pauschale Vorgaben aus Rom fehl am Platz. Der Entwurf sei ein guter Kompromiss, kein Allheilmittel, aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, für den er den beiden Landeshauptleuten dankte.
Stefania Segnana (Lega) dankte ebenfalls den Landeshauptleuten sowie der Kommissionspräsidentin Angeli für die Arbeit. Das Ergebnis der Verhandlungen sei eine notwendige Anpassung, wie auch von der ehemaligen Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts, Daria de Pretis, bestätigt worden sei. Die Reform bringe wesentliche Änderungen zu wichtigen Sachbereichen, aber auch eine Absicherung der Autonomie vor künftigen Regierungen. Zu oft seien nach der Verfassungsreform von 2001 unsere Bestimmungen von Rom angefochten worden, und 25 Jahre lang sei nichts passiert, um dem zu begegnen.
Videoaufnahmen von der Sitzung am 14.05.2025:
Fotos: